Auf dieser Seite finden sie ein paar Texte/Essays, von denen ich hoffe, dass sie für sie hilf- oder aufschlussreich sein könnten.
Das Gehirn eines Kindes entwickelt sich in drei verschiedenen Stadien.
Zunächst entwickelt sich das Überlebens- oder Reptiliengehirn, das aus dem Hirnstamm besteht. Der Hirnstamm enthält das autonome Nervensystem und das Zentralnervensystem, die für automatische Funktionen wie Atmung, Herzfrequenz und Temperaturkontrolle verantwortlich sind. Das emotionale Gehirn oder das limbische System kommt im Alter zwischen 1 und 2 Jahren zum Einsatz. Wir sehen dies bei den „schrecklichen Zweiern“, wenn Kinder anfangen, Wutanfälle zu bekommen und ihre Emotionen richtig heftig werden. Schließlich beginnt die Entwicklung des denkenden Gehirns oder des präfrontalen Kortex, meist zwischen 5 und 7 Jahren. Hier beginnen sich logisches Denken, Argumentation, Führungsfunktionen und Entscheidungsfindung zu entwickeln.
Sehr kleine Kinder haben so gesehen nur einen Hirnstamm und ein limbisches System, so dass es sehr wenig rationales Denken gibt, mit dem man arbeiten kann und eine Regulation der Emotionen noch gar nicht stattfindet. Obwohl sich dies langsam mit zunehmendem Alter ändert, erlernen wir alle den für uns prägenden Umgang mit unseren Emotionen bis zu unserem 7. Lebensjahr, wenn wir den präfrontalen Kortex zu verwenden beginnen.
Als Jugendliche und Erwachsene verändert sich unser Umgang mit Emotionen demnach nur dann im Nachhinein, wenn wir dies bewusst beabsichtigen und üben (im positiven Sinne) oder wenn unsere Hirnstruktur durch andauernden Stress oder Traumata in Mitleidenschaft gezogen wird (im negativen Sinne).
Für einen positiven Umgang mit unseren Emotionen ist das konkrete Benennen einer Emotion oder eines Gefühls oft eine große Hilfe. Das heißt, das nächste Mal, wenn in dir eine starke Emotionen aufkommt, dann benenne die Emotion am besten zuerst beim Namen und ordne sie einen gewissen Körperteil zu (das ist manchmal leichter, als zu sagen was genau du fühlst), z.B Hitze in der Brust oder einen Knoten im Bauch etc. und atme dann dreimal hintereinander langsam und tief ein bis deine Lungen ganz voll sind. Weil wir unsere Emotionen in unserer Kindheit nicht bewusst regulieren, sondern ihnen eher erliegen, kann sich diese Übung zunächst seltsam oder ineffektiv anfühlen, aber mit der Zeit wird sich das ändern.
Komm dann zur Ruhe und akzeptiere was du fühlst.
Oft verbinden wir eine intensive Emotion mit einem spezifischen Impuls, wie zum Beispiel etwas zu essen oder Geld auszugeben, wenn wir angespannt sind.
Auf diese Weise konditionieren wir uns leider oft selbst dysfunktionale
Verhaltensmuster an.
Wir sollten uns stattdessen aber sagen:
Ich fühle mich jetzt gerade aufgebracht und bin emotional, aber das ist okay.
Ich darf mich so fühlen.
Auf diese Weise beginnen wir uns selbst zu validieren. Wir erkennen unsere Emotionen – so wie sie sind – an. Anschließend solltest du dich zu bewegen beginnen. Bewegung kann helfen, Emotionen loszuwerden.
Am besten sind Spaziergänge, aber du kannst auch mit einem Seil springen oder kurz etwas im Haushalt tun, sodass du an mehr Bewegung kommst. Auch Weinen ist erlaubt und sogar erwünscht, denn mit den Tränen werden deine Emotionen herausgelassen.
Würden wir uns nicht bewegen oder weinen, dann würde unser Körper immer im Fight / Flight / Freeze Modus steckenbleiben.
Gleichzeitig sollten wir uns daran erinnern, nie dauerhafte Entscheidungen zu treffen während wir temporäre Emotionen fühlen— hol deine Emotionen deswegen erst aus deinen Körper heraus, bevor du eine Entscheidung triffst. Und versuche generell öfter, dich dazu zu entscheiden, dich selbst zu ermächtigen, indem du nicht blind deinen Emotionen erliegst, sondern sie selbst regulierst. „Regulieren anstatt Reagieren“ und „Akzeptieren statt Unterdrücken“ ist hierbei die Regel.
Ansonsten gilt bei der Regulation von Emotionen was sonst aus gilt: Übung. Übung. Übung.
Desto häufiger du diese Schritte erfolgreich gemeistert hast, desto einfacher wird es. Niemand ist perfekt darin, seine Emotionen zu verarbeiten und es gibt niemals zwei Emotionen, die dasselbe sind oder denselben Ablauf haben. Das ist gar nicht möglich. Aber es ist dennoch möglich, mit unseren Emotionen anstatt gegen sie zu arbeiten und dir selbst nie das bewusste Fühlen deiner Emotionen zu verbieten, denn unterdrückte Emotionen kommen später im Verlauf unseres Lebens in hässlicheren Formen zurück und üben ihren destruktiven Einfluss auf uns aus. Unsere Emotionen wollen sich Gehör verschaffen – ob durch Wutanfälle, Krankheiten, Süchte oder ernsthaften Depressionen. Das schlimmste was wir also machen können, ist, unsere Emotionen als Schwäche abzutun, sie zu ignorieren oder gegen sie zu arbeiten.
Viele Philosophen – unter ihnen Sokrates, Kierkegaard und Nietzsche – waren entschieden gegen gruppenähnliche Zusammenschlüsse und deuteten immer wieder auf ihre Gefahren hin. Gruppendenken verleitet uns dazu, unseren eigenen Verstand zugunsten der Motive anderer Menschen aufzugeben und kann auf diese Weise unschöne Formen annehmen.
Bernays schrieb hierzu: ‚Menschen werden in hohem Maße von Motiven angetrieben, die sie vor sich selbst verbergen. Es ist offensichtlich, dass der erfolgreiche Propagandist die wahren Motive verstehen und sich nicht damit zufrieden geben muss, die Gründe zu akzeptieren, die Menschen für ihr Handeln angeben“ (Propaganda).‘
Ein einzelner Mensch mag die nötige Reflektionsfähigkeit aufweisen, um seine tieferen Motive für individuelle Handlungen zu verstehen, doch in der Gruppe kommt es zu einem Prozess der —Deindividuation— genannt wird.
Dies bedeutet: Durch die Identifikation mit der Gruppe gibt das Individuum die Selbstanalyse zugunsten der Wahrung der Gruppenidentität auf. Heutzutage wird diese Möglichkeit, das Unbewusste direkt anzusprechen, von der Populärkultur und den Massenmedien aufgegriffen, um Aufmerksamkeit und Sehnsucht zu erregen. Dieses Phänomen, auch bekannt als ‚divide and conquer‘ könnte jedoch negative Konsequenzen für die Stabilität und Freiheit eines Kollektivs besitzen, da den Machthabern auf diese Weise ermöglicht wird, die Masse ganz nach ihren Vorstellungen zu lenken.
Schon Machiavelli schrieb, dass diejenigen, die die Macht über eine Bevölkerung wahren wollen vor langer Zeit erkannt haben, dass eine vereinte Masse für sie zur Bedrohung werden und das System stürzen könnte. Daher wurde stets versucht, die Kraft der Mehrheit zu schwächen. Durch Teilungen in Klasse, Beruf, Alter etc. konnte dies erreicht werden. Gruppen wie diese lassen den rationalen Diskurs unwahrscheinlich werden, weil all diese Gruppen mit Emotionen und Identifikationen verbunden sind, die die Gruppenidentität aufrechterhalten.
So wird nicht nur die Bevölkerung als Ganzes geschwächt, sondern ihre Augen werden auch von den Handlungen derer abgelenkt, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Die nach Bernays Worten ‚unsichtbare Regierung, die das Schicksal von Millionen lenkt‘, kann ungehindert ihrem Treiben nachgehen. Dabei sind Zugehörigkeitsgefühle zu Gruppen aber nicht immer negativ, sie können auch sehr positiv sein. Nur wenn die eigene Identität an eine Gruppe gebunden wird, birgt dies immer eine gewisse Gefahr.
Denn in dem Moment, in dem eine Gruppe die Subjektfunktion ersetzt, zeigt sich die Gefahr einer Regression des Bewusstseins, und damit auch eine pathologische Tendenz, die der Einzelne überwinden muss, um die Gesellschaft zu schützen.
Nietzsche differenzierte diesbezüglich zwischen sogenannten „höheren Menschen“ und „Herdenmenschen“ – zu Ersteren gehören ihm zufolge kreative Genies wie Beethoven und Menschen, die fernab der Öffentlichkeit leben. Doch ihr Leben unterscheidet sich qualitativ nicht von dem Leben schöpferischer Genies, denn beide haben einen ähnlichen Charakter, der sie auf wesentliche Weisen von der Herde/ der Masse unterscheidet. Diese höheren Menschen scheinen oftmals eine Art Lebensprojekt zu haben, in das sie ihre Energien stecken können, das zu ihrem Vermächtnis wird. Nicht kurzfristige Befriedigung und Glück, sondern Anstrengungen und harte Arbeiten, deren Wirkungen über Jahrhunderte hinausgehen und oftmals den eigenen physischen Tod überstehen werden, zeichnet sie aus. Nietzsche schrieb hierzu in ‚Menschliches allzu Menschliches’: ‚Der moderne Mensch orientiert sich zu sehr an seiner eigenen kurzen Lebensspanne und möchte die Früchte des Baumes, den er pflanzt, selbst pflücken. Deshalb mag er jene Bäume nicht mehr pflanzen, die jahrhundertelang ständiger Pflege bedürfen und über viele Generationen hinweg Schatten spenden sollen.‘
Für solche Projekte benötigt es jedoch Abstand von der Herde, um die nötige Eigenwilligkeit und Originalität zu entwickeln, die für solche Werke nötig ist. Auch muss der Blick für die Mängel gestärkt werden, sodass die Fehler der eigenen Generation objektiver gesehen werden können. Nietzsche schrieb, dass das Konzept der Größe auch bedeutet, edel zu sein. Das wiederum bedeute, alleine sein zu können, anders sein zu können und Unabhängigkeit zu entwickeln. Menschen dieser Art haben nach Nietzsches Auffassung Besseres zu tun, als sich Lästereien oder Trends anzuschließen und Lob oder Kritik anderer Menschen treffen solche Menschen kaum, weil sie bewusst wissen, dass dieselben Menschen, die bei ihrer Krönung applaudieren auch ihre Enthauptung feiern würden — sie erkennen, dass Menschen triebgesteuert sind und sich in den meisten Fällen mehr nach einer Show als nach der Wahrheit sehnen. Immer im Bewusstsein der wichtigen Aufgaben, die vor ihnen liegen und des Potentials zur Größe, das ihnen immanent ist, empfinden die erhabenen Menschen —im Gegensatz zur abgestumpften Masse— Ehrfurcht vor sich selbst. Sie empfinden Selbstrespekt.
Sieht man sich auf TikTok oder Instagram um, sieht ein Großteil des viralen Contents nicht unbedingt nach Selbstrespekt aus.
Die Herde besteht nach Nietzsche aus ebenfalls zwei Arten: Dem Letzen Mann und dem Sklaven. Der letzte Mann ist der typische durchschnittliche Mann, der um Lust und Zufriedenheit kämpft, was ihn schwach und abhängig werden lässt. Er ist völlig frei von schöpferischen Instinkten, die er gar nicht erst zu befriedigen versucht und er kann die inneren Werte, die eine höhere Kreativität ermöglichen auch nicht verkörpern, weil er sie überhaupt gar nicht erst kennt.
Der Sklave demgegenüber ist schwach und kränklich. Er ist von sogenannten Ressentiments erfüllt — Ihn erfüllt ein Hass auf das Leben und ein Gefühl der Hilflosigkeit, denn die Realität erscheint ihm überwältigend und bedrohlich.
Das Gefühl des Ressentiments weckt bei ihm dann Gefühle des Neides und richtet sich an all diejenigen, die nicht so sehr leiden müssen wie er, also die höheren Menschen. Dieser Neid motiviert die Sklaven, sich zusammenzufinden, um sich an den höheren Menschen zu rächen. Nietzsche führt als Beispiel den Tod des Sokrates an, der von einem wütenden Mob verurteilt und letztlich hingerichtet wurde. Menschen erlangen in der Masse (dem „Mob“) eine gemeinsame Macht, die sie im Einzelnen nicht besitzen würden und beginnen unter dem Vorwand nach Gleichberechtigung oder Gerechtigkeit alle möglichen Anforderungen zu stellen, um die Schere der Hierarchie auf ein mittelmäßigeres Niveau zu bringen und sich selbst auf diese Weise erhöhen zu können. Oder kurzgesagt: Um den höheren Menschen kleinzuhalten.
Diese Moral, nach der geschrien wird, nennt Nietzsche die Untergangsmoral Par excellence: Denn man ruft nach dem Sinken eines anderen Menschen, weil man sich selbst auf einem geringeren Niveau befindet.
Die natürlichen Werte des Lebens werden in so einer Moral umgekehrt und das Leben geleugnet: Individuen die stark und unabhängig sind, wirken -gerade aufgrund ihres freien Geistes und ihrer Unabhängigkeit- auf die Moral der Masse/Herde bedrohlich. Daher werden diejenigen, die eine solche Bedrohung darstellen, schnell zum Ziel der Masse. Die als Richter verkleideten rachsüchtigen wirken demgegenüber als gut.
Die Herdenmoral ist angesichts ihrer Kunst der Verführung eine der größten Gefahren für das moderne Kollektiv. Denn diejenigen, die nach Größe und Unabhängigkeit streben, werden aufgrund der negativen und sanktionierenden Reaktionen der Anderen eingeschüchtert und ängstlich. Sie sollen „klein gehalten“ werden. Und natürlich ist dies auf Dauer ein Zustand, der zu inneren Spannungen führen muss, daher kann die Moralität der Herde irgendwann selbst auf den starken Menschen wie der Gesang von Sirenen wirken.
Wenn diese Moral der Herde zu mächtig wird, kommt es zu kollektiven Formen von Nihilismus. Kreativität, so wie Werke von großer moralischer Kraft und Schönheit, werden dann immer seltener und an ihre Stelle treten dann niedere Werte wie Komfort, Drogenkonsum oder Gemütlichkeit.
Um zu vermeiden, dass die Generationen der Zukunft diesem überwältigenden Einebnungseffekt zum Opfer fallen, hat Nietzsche die „Umwertung der Werte“ geschrieben.
Dies bedeutet, dass der höhere Mensch zunächst einmal die Moral der Herde als solche erkennen muss und sich dann bewusst von dieser abgrenzen soll.
Die Moral sollte innerhalb der Herde bleiben, während der höhere Mensch seine eigenen höheren Werte unabhängig von dieser erkennen und ausleben soll. Die Moral des höheren Menschen ist daher auch von einer tiefen Einsamkeit abhängig — zu gefährlich wäre es, würde er versuchen, seine Werte den anderen Menschen anzupreisen.
Denn es gibt immer eine Plethora an Individuen, die diejenigen, die sich von der Masse abheben, systematisch zerstören, klein halten und ihren Neid unter dem Ruf nach Gerechtigkeit verbergen wollen.
Sie verstehen die „höheren Menschen“ nicht. Ihre Einsichten klingen für diejenigen, die sie nicht selbst erarbeitet haben oder verstehen können nicht selten wie Verbrechen oder Wahnsinn. Die Evolution menschlicher Exzellenz, der Nietzsche Vorarbeiten und die er ermöglichen wollte, ist per Definitionem nichts, das von der Masse verkörpert werden kann.
Die „Herdenmoral“ war für Nietzsche auch eine Bedrohung, weil sie von den falschen Motiven des Sklaven angetrieben wird: Neid und Groll. Misanthropie. Nihilismus. Wenn solche Menschen ihre Ziele nicht erreichen, dann wollen sie an der Welt Rache nehmen und denken nach dem Motto: ‚wenn ich nicht mein Glück nicht finden kann, dann sollen allen am Unglück ersticken.‘ Man denke nur einmal an einen zurückgewiesenen und verbitterten Hitler, der von der Kunstakademie abgewiesen wurde und zu einer mehr als tödlichen Sublimierung seiner Bitterkeit gegriffen hat.
Im Westen geht es um soziale Anerkennung, also um Erfolg in der äußeren Welt – in Mode, Status, Geld oder Beruf. Aber diese übermäßige Orientierung auf die äußere Welt ist ungesund. Carl Jung schrieb in „Psychologie und Religion“, dass derjenige, dessen Interessen alle außerhalb von seinem Selbst liegen, sich nie mit dem Notwendigen zufrieden geben, sondern sich ständig nach etwas Größerem und Besserem sehnen wird, das er getreu seiner sozialen Konditionierung immer außerhalb seiner selbst sucht. Dabei vergisst derjenige völlig, dass er trotz all seiner äußerlichen Erfolge innerlich immer Derselbe bleibt. Das äußere Leben kann zwar immer mehr Verbesserung und Verschönerung vertragen, aber diese Dinge verlieren ihre Bedeutung, wenn der innere Mensch nicht mit ihnen Schritt hält.
Wenn die innere Psyche nicht parallel zur äußeren Opulenz, die viele von uns anstreben oder als erstrebenswert erachten, verschönert wird, dann führt dieser Kontrast der Inneren Leere vor dem Gegensatz der äußeren Fülle zu Depressionen und zu tiefer Traurigkeit.
Dabei fühlen wir uns häufig umso schuldiger für unsere Traurigkeit oder unsere psychischen Konflikte, wenn wir gemäß aller gesellschaftlichen Vorstellungen eigentlich glücklich sein sollten.
Auch Jung räumt ein, dass äußerer Erfolg zweifellos eine unschätzbare Quelle des Glücks sein kann; der innere Mensch aber weiterhin seinen Anspruch auf Aufmerksamkeit erheben wird, weil er nicht durch äußeren Besitz oder Erfolg befriedigt werden kann.
Leider ist es so, dass viele Menschen auf ihrer Suche nach dem Glück tatsächlich immer weniger auf ihre innere Stimme hören, die sie zurück zu sich selber führen möchte, bis sie immer leiser wird und irgendwann ganz verstummt.
Desto mehr der innere Mensch von uns ignoriert wird, desto mehr wandelt er sich für uns zu einer Quelle unerklärlichen Unglücks und unverständlichen Leids inmitten von Lebensbedingungen, die eigentlich alles zu bieten scheinen, so Jung. Die exzessive Veräußerlichung des Lebens kann demnach als Quelle signifikanten Leids angesehen werden.
Ich habe oft gesehen, wie unzufrieden gerade sehr erfolgreiche Menschen im tiefsten Inneren wirklich sind, weil sie ihr Seelenleben auf dem Weg nach oben nicht kultiviert, sondern zugunsten äußeren Reichtums vernachlässigt haben.
Ich habe gesehen, wie neurotisch und narzisstisch sie werden, obwohl sie vorher eine Reinheit hatten, die Narzissmus scheinbar nie zugelassen hätte.
Viele von uns machen den Fehler, nach Position, Heirat, Ruf, äußerem Erfolg oder Geld zu streben, weil wir denken, dass dies der Weg aus unserer Leere sei, nur um dann festzustellen, dass wir selbst dann noch unglücklich und neurotisch bleiben, wenn wir diese Dinge erreicht haben.
Ich denke, wir wissen oft nicht, wonach wir suchen, weil wir es nicht sehen können. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht fühlen können.
Denn letztlich steckt hinter der Suche nach Erfolg und materiellem Reichtum immer die Sehnsucht nach gewissen Gefühlen:
Wir wollen uns frei oder bewundernswert oder geliebt oder jung oder unabhängig fühlen.
Dabei sind Gefühle dieser Art immer in uns, selbst wenn wir sie nicht immer fühlen können. Wir würden, davon bin ich überzeugt, ein viel glücklicheres Leben führen, wenn wir diese Gefühle zu kultivieren erlernen würden, anstatt sie im Außen zu suchen — wenn wir lernen würden, in unserer eigenen Seele heimatlich zu werden. Wenn wir ihre Schönheit kultivieren würden und in diese jederzeit eintauchen könnten. Das würde uns die höchsten aller Gefühle und tiefsten aller Emotionen schenken.
Nach Jung sind viele nach äußerem Erfolg suchende Menschen auf einen zu engen spirituellen Horizont beschränkt.
Würde es ihnen ermöglicht werden, sich zu weitläufigeren bzw. Holistischeren Persönlichkeiten zu entwickeln, würden ihre Neurosen allmählich verschwinden.
Jung wusste, dass eine der wichtigsten Fragen die wir uns stellen können mit unserer Spiritualität zu tun hat: Ob wir mit der Unendlichkeit verbunden sind oder nicht entscheidet ihm zufolge darüber, ob wir das wirklich Wichtige erkennen können, anstatt unsere Interessen auf Sinnlosigkeiten zu richten, die keine wahre Bedeutung haben.
Tatsächlich fordern wir alle oft, dass die Welt uns für Qualitäten wie Talent oder Schönheit bewundert. Und wenn sie das nicht tut, fühlen wir uns ungesehen oder ausgenutzt. Je mehr Wert jemand auf falsche Besitztümer legt, desto geringer ist sein Sinn für das Wesentliche und desto unzufriedener wird er.
Man beginnt dann, sich eingeschränkt zu fühlen, denn man erkennt, dass die eigenen (oberflächlichen) Träume begrenzt waren und die eigenen Erfolge sich als imitierbar herausstellen. Die Folgen sind Neid und Eifersucht. Aber diejenigen unter uns, die eine Verbindung zu etwas Höherem aufbauen konnten; diejenigen, die verstehen, dass wir hier in diesem Leben bereits eine Verbindung zum Unendlichen erahnen können, besitzen andere Wünsche und Einstellungen zum Leben — und darin liegt das Geheimnis ihrer inneren Erfüllung.
Frantic in my fury I had no time for decisions; I only remembered that death in battle is glorious.‘ says Virgil in The Aeneid.
Irgendwie spiegelt dies den aktuellen Stand der Dinge wider: Wir leben in ständiger Eile, sogar unsere Freizeit wird zur Ware, weil der Kapitalismus, wie Byun-Chul Han beschreibt, an einen unbewussten Todestrieb gebunden ist.
Demnach ist das, was wir heute als Wachstum bezeichnen, in Wirklichkeit ein tumoröses Wachstum. Es handelt sich um eine krebsartige Wucherung, die den sozialen Organismus stört. Diese Tumoren metastasieren endlos und wachsen mit einer unerklärlichen, tödlichen Vitalität. Aber dieses Wachstum ist nicht mehr produktiv, sondern wird destruktiv.
Die zerstörerischen Kräfte des Kapitalismus verursachen nicht nur ökologische und soziale Katastrophen, sondern auch psychische Zusammenbrüche – wie die steigende Zahl psychischer Erkrankungen belegt. Doch unser System ist zu schlau, um seine Toxizität offen zu zeigen: Der destruktive Leistungszwang vereint Selbstbestätigung und Selbstzerstörung in einem, sodass es in seiner stillen Destruktivität ungestört fortfahren kann.
Ähnlich wie der versteckte Narzissmus zwar nicht sichtbar, seine Folgen aber spürbar sind, so unterstützt das von uns hochgehaltene System den Narzissmus nicht nur, sondern fördert ihn aktiv und strebt gleichzeitig nach Vernichtung. Wir alle streben nach Selbstverbesserung und immer nach gesünderen Lebensstilen, um uns selbst besser outsourcen zu können – und wir tun dies mehr oder weniger bewusst. Wir als Menschen optimieren uns bis in den Tod.
Freud führte den Todestrieb zunächst zögerlich ein, gab aber später zu, dass er nicht darüber hinaus denken konnte —die Idee des Todestriebs wurde in seinem Denken immer wichtiger. Der Todestrieb ist der zugrunde liegende Antrieb des Kapitalismus, denn viele von uns betrachten die Anhäufung von Geld als Mittel, unser Leben zu bereichern und zu verlängern – wir handeln in der Illusion, dass mehr Kapital weniger Tod bedeuten würde (in seelischer wie physischer Hinsicht).
Kapital scheint ein Sicherheitsnetz zu sein, in das man springt, um vor Depressionen, psychischen oder physischen Krankheiten oder einem vorzeitigen Tod zu fliehen zu versuchen. Ironischerweise opfern wir Menschen uns für diesen falschen Gott – einem Gott, der kein Leben nach dem Tod, sondern ein Leben darüber hinaus verspricht. Ein tragendes Element des Todestriebs in unserer Gesellschaft ist die Auto-Aggression, die notwendig ist, um ein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft zu bleiben. Die Gewalt, die die ständige Leistung der Seele zufügt.
Dabei besitzt diese Dynamik nach Byun-Chul Han aber viel tiefere Ursprünge: Denn die Etymologie des Geldes deutet nach Byun-Chul Han bereits auf den Opfer – und Kultzusammenhang hin. Wer früher viel Geld besaß, konnte Opfertiere erwerben, kam quasi in den Besitz einer göttlichen Tötungsgewalt: „Geld ist von seiner Wurzel im keltischen Opfer her gleichsam wie tiefgefrorenes Opferblut. Mit Geld um sich zu werfen, es fließen zu lassen und fließen zu sehen, erzeugt einen ähnlichen Effekt wie das fließen von Blut im Kampf oder auf dem Opferaltar.“
Das im Besitz wissende Geld verleiht dem Besitzer den Status eines Raubtiers
und immunisiert diesen so gegen Gefahr und ggf. Sogar gegen den Tod. Aus tiefenpsychologischer Perspektive wird der archaische Glaube fortgeführt, dass das akkumulierte Vermögen zum Töten den Tod abwenden könnte.
Der Kapitalismus wäre demnach ein vom Tod besessenes System — der ständige Akkumulations- und Wachstumszwang manifestiere sich vor dem Hintergrund eines drohenden Todes.
Dabei sorgt der destruktive Leistungsdruck dafür, dass Selbstbehauptung und Selbstzerstörung in eines zusammenfallen und voneinander untrennbar werden und das Leben auf ein ‚Überleben‘ reduziert wird — die Abtrennung und Distanzierung des Lebens vom Tod, die im Kapitalismus stattfindet gebiert ein ‚Tod im Leben‘ beziehungsweise ein untotes Leben. Wir als Menschen werden zu Funktionalitäten von Maschinerien verdinglicht, wir ernähren uns synthetisch und besitzen synthetische Emotionen, die ausgeprägte Formen der Selbstentfremdung aufweisen.
Auf symbolischer Ebene zeigt sich der Tod nicht direkt im Dreck oder in Exkrementen, denn so würde er sich seiner Maske entblößen. Stattdessen zeigt er sich, wie Erich Fromm aufzuzeigen versuchte, in sauberen glänzenden Maschinen und in weißen Westen. Weil die Unsterblichkeit im System nur um den Preis des Lebens zu erlangen ist, resultiert daraus eine torlose und untote sowie verdinglichte und maschinelle Existenz, die den Begriff Leben teilweise gar nicht mehr verdient zu haben scheint.
Aus historischer Sicht unterscheidet sich die gegenwärtige Ära des Neoliberalismus, in der „jeder von uns ein Unternehmer für sich ist“, von der Zeit von Marx, denn „was wir hatten, war Ausbeutung durch andere. Heute herrscht Selbstausbeutung – ich beute mich selbst aus in der Illusion, dass ich tatsächlich persönliche Erfüllung finde.“
Heute sei alle Zeit gleichzusetzen mit Arbeitszeit, was wiederum nicht nur bedeute, dass wir zu lange oder zu hart arbeiten würden, sondern, dass alle Zeit im Verhältnis zur Arbeit gesehen würde. Wir scheinen zu denken, dass alles, was nicht gemessen wird, nicht real ist. Wir verbinden Zeitmanagement und das Erstellen von Listen mit unserem Überlebensgefühl. Das Gefühl, Listen zu erstellen, etwas zu Papier zu bringen, gibt uns die Illusion von Kontrolle – und das, weil Worte für alle Ewigkeit nicht gelöscht werden können.
Wie Umberto Eco in einem SPIEGEL-Interview mit Susanne Beyer und Lothar Gorris vom 11. November 2009 feststellt: „[…] Wir haben eine Grenze, eine sehr entmutigende, demütigende Grenze: den Tod. Deshalb mögen wir all die Dinge, von denen wir annehmen, dass sie keine Grenzen und daher kein Ende haben. Es ist eine Möglichkeit, Gedanken über den Tod zu entkommen. Wir mögen Listen, weil wir nicht sterben können.“
Sobald wir unsere Aufgaben erledigt haben, erstellen wir dann neue Listen – und suchen weiterhin nach neuen Missionen, die wir erfüllen können, um die Vorstellung zu beseitigen, dass das, was wir tun, mit der Zeit tatsächlich verschwinden könnte, genau wie der Sinn unserer gesamten Existenz. Genau wie wir selbst. Indem wir den Tod ins Überleben verdrängen, distanzieren wir uns vom eigentlichen Leben.
„Die Ironie des Zustands des Menschen besteht darin, dass das tiefste Bedürfnis darin besteht, frei von der Angst vor Tod und Vernichtung zu sein; aber es ist das Leben selbst, das es erweckt, und deshalb müssen wir davor zurückschrecken, vollständig lebendig zu sein.“ schrieb Ernest Becker in „Die Verleugnung des Todes“.
Und wir scheuen davor zurück, vollständig lebendig zu sein: Wir misstrauen der Lebendigkeit, denn sie ist ja nicht messbar. Aber wie könnte man das Leben messen? Mit Sicherheit nicht daran, wie viele Aufgaben erledigt wurden.
Was wäre, wenn wir unsere Leben daran messen müssten, wie viel Leidenschaft wir verspürt haben oder wie oft wir von der Arbeit freikommen konnten?
Das Problem ist die Tabuisierung des Todes in unserer westlichen Kultur, so Byun-Chul Han. Wir wollen einfach nicht, dass Dinge sterben. Wir haben Angst, das Alte loszulassen und mit dem Neuen weiterzumachen. Der Mensch muss daran erinnert werden, dass das Leben zyklisch und nicht linear ist.
Die in sich selbst erfüllte und im Sinne Carl Jungs voll aktualisiere Frau ist eine Instanz, die weiß, dass das Leben zyklisch ist und die sich mit jedem neuen Kreis, den sie betritt, häutet. Wenn wir wüssten, wie man seine Haut abwirft, müssten wir anderen nicht die Haut abzuziehen versuchen. Wir müssten nicht in dieser Endlosschleife an Konkurrenz- und Leistungsdenken gefangen sein.
Hades galt als griechischer Gott der Unterwelt. Er ist eine weitere Erinnerung daran, wie eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Tod aussehen kann — in der Antike hatte er nur wenige Schreine, wurde aber bei Bestattungszeremonien verehrt und spielte eine tragende Rolle in den Mysterienkulten. Sein Kultzentrum in Griechenland war das Totenorakel in Thesprotia. Das Nekromanteion war ein Tempel, der Hades und Persephone gewidmet war. Hierhin ging man, um mit den Toten zu sprechen, und es wurde angenommen, dass es sich um die Tür zum Reich des Hades handelte.
Laut Sokrates sollte der Tod ruhig wahrgenommen werden und der Sterbende sollte sich „gesegnet“ fühlen, weil der Moment seiner Katharsis gekommen sei — seiner Erleichterung.
Dies ist jedoch ein Glaube, der im Laufe der Zeit nicht an die modernen Griechen bzw. An die moderne Welt weitergegeben wurde.
Auch wenn das griechische Jenseits ein unsicherer und beängstigender Ort war, der in der griechischen Mythologie erfasst ist und der den heutigen Glauben der Menschen im antiken Griechenland prägt, war die Erinnerung an die Toten ein wichtiger Bestandteil des Lebens – der Tod mag beängstigend gewesen sein, war aber immer sehr präsent. Die alten Griechen hatten eine lebensbejahende Sicht auf den Tod. Und das ist wichtig. Damit das Leben seine Magie entfalten kann, müssen wir auch den Tod seine Segnungen entfalten lassen.
Über schmerzhafte Ereignisse zu sprechen, schafft nicht immer unbedingt Gemeinschaft – oft ganz im Gegenteil. Familien und Organisationen können Mitglieder ablehnen, die ihre schmutzige Wäsche lüften; Freunde und Familie können die Geduld mit Menschen verlieren, die in ihrer Trauer oder ihrem Schmerz steckenbleiben. Dies ist einer der Gründe, warum sich Opfer von Traumata oder anderen belastenden Situationen oft zurückziehen und warum ihre Geschichten zu Routineerzählungen werden, die so bearbeitet wurden, dass sie am wenigsten Ablehnung hervorrufen.
Kinder, die zu oft auf sich selbst zurückgeworfen wurden und zu früh selbstständig werden mussten, entwickeln möglicherweise eine ablehnende Haltung gegenüber ihren eigenen Gefühlen. Vielleicht haben sie gelernt, Abstand zu schmerzhaften Gefühlen zu halten, von denen sie wussten, dass ihre emotional unreifen Eltern sie nicht hätten verstehen können. Wenn Eltern Ihren Kindern nicht beibringen, ihre Gefühle zu verbalisieren, werden sie zu Erwachsenen, die abschalten, wenn sie etwas anderes als Glück empfinden.
Es gibt eine Passage in einem der Plato-Dialoge, in der Sokrates sagt, dass idealistische Menschen oft menschenfeindlich werden, wenn sie 2-3 Mal enttäuscht wurden. Plato äußert daraufhin, dass das durchaus passieren kann auf der Suche nach dem Sinn des Guten. Man sollte jedoch nicht desillusioniert werden, wenn man nicht fündig wurde. Alles, was man entdeckt habe, sei, dass die Suche schwierig sei und wir immer noch die Pflicht hätten, weiter zu suchen.
Tatsächlich kann die Tatsache, dass wir Schmerzen in unsere Herzen und Verwirrung in unseren Seelen fühlen uns dahingehend beruhigen, dass sie bedeuten, dass wir immer noch am Leben sind, immer noch ein Mensch unter Menschen und immer noch offen für die Schönheit dieser Welt.
Trotzdem glaube ich fest an die heilende Kraft des Dialogs und an die Macht von Geschichten und Fiktionen, die uns durch unsere Trauer tragen können.
Wenn wir uns in einem tiefen Traumata befinden, zögern wir oft zu sprechen — wir beginnen zu stottern oder es schleichen sich lange Pausen in unsere Sätze. Wenn so etwas passiert, können wir zu unserer Sprache durch die Sprache anderer zurückfinden.
Wir können uns den Gedichten zuwenden. Wir können uns den Büchern zuwenden. In den meisten Fällen war jemand bereits vor uns an diesen seelischen Orten der Trauer oder Einsamkeit und ist tief genug in sie eingetaucht, um uns die passenden Worte zu geben.
„Am Anfang war das Wort und das Wort formte die Welt“, heißt es.
Die Macht über Leben und Tod liegt auf unserer Zunge und die Rundungen unserer Lippen haben, wie Oscar Wilde wusste, die Macht, Geschichte zu schreiben. Sprache ist kein harmloses Unterfangen. Worte haben die Kraft, unser Bewusstsein zu verändern, sodass die Substanz unserer Seele beeinflusst wird. Und die Seele eines anderen Menschen zu erreichen, bedeutet heiligen Boden zu betreten.
„Literatur hat mir mehrmals das Leben gerettet“, sagte mir eine Freundin. Wenn sie Gefühle hatte, die sie nicht abschütteln konnte, die sich so schwer und paralysierend anfühlten und sie dann über ein Gedicht oder ein Zitat eines Menschen vor Jahrzehnten- oder Jahrhunderten stolperte, dass auf ihre Situation zutraf, dann fühlte sie sich plötzlich tief damit verbunden — sie wurde daran erinnert, dass es Hoffnung gab!
Die perfekte Anordnung von Worten kann eine seit Jahren bestehende Wunde im Herzen innerhalb von Sekunden durch eine neue Erkenntnis heilen! Die Kraft der Literatur ist real.
Kultur ist wichtig. Dies sagt auch die französische Schauspielerin Léa Seydoux-Fornier.
Wörtlich: „Literatur rettet dich, Kino rettet dich.“
Denn manchmal geben diese Medien uns den tragenden Impuls zu den Bewusstseinsveränderungen, die in uns notwendig sind: Wie eine Schlange, die sich häutet, muss man alte Perspektiven oder Gedanken ablegen, um weiterleben oder wieder lebendig werden zu können, anstatt nur zu existieren. In die Tiefe und Weite zu gehen macht den Unterschied zwischen Leben und Existieren aus. Man muss sich dazu entscheiden, nach dem Neuen zu greifen und manchmal muss man tiefer suchen, um wahres Gold finden zu können.
‚Bewusstsein spiegelt sich in einem Wort wider wie eine Sonne in einem Wassertropfen. Ein Wort verhält sich zum Bewusstsein wie eine lebende Zelle zu einem Ganzen Organismus, wie ein Atom zum Universum. Ein Wort ist ein Mikrokosmos des menschlichen Bewusstseins’, schreibt Lev Vygotsky in „Thought and Language“. Und da Bewusstsein mit Bewusstsein interagiert und sich gegenseitig verändert, besitzen Worte die Kraft, in unser menschliches Bewusstsein zu dringen, wie Impfungen in Zellen oder Medizin in Blutbahnen.
Wir Menschen bewegen uns im Licht, man kann nie alle Seiten gleichzeitig ausleuchten – man wird nie alles vom Anderen sehen können, aber man sollte seiner Seele poetisch gerecht werden und zumindest verschiedene Perspektiven der eigenen Seele kennenlernen, um zu sehen, woher der Schmerz kommt, wo der Splitter zu finden ist.
Um eine Wunde zu heilen, muss man aufhören, sie zu berühren – und Literatur hilft bei beidem. Denn sie wirft einerseits Licht auf die Wunde und verwandelt sich dann wieder in Dunkelheit – und lenkt den Leser von seinem eigenen Leiden ab, indem sie seine Konzentration auf verschiedene Erzählungen, Charaktere oder Wendungen in den Handlungssträngen legt.
Doch unabhängig davon, wo das Licht gerade steht, ist es wichtig zu bedenken, dass ein aufmerksamer Leser sowie ein offener Rezipient von Kunst diese immer nur so tief kennenlernen kann, wie er sich selbst kennenzulernen bereit ist und vice versa.
Die Arbeit des Künstlers oder Autors ist dabei oft nur eine Art optisches Instrument, das er dem Rezipienten zur Verfügung stellt, damit dieser selbst erkennen kann, was er sonst vielleicht nie gesehen hätte. Verschiedene Seiten und Winkel zu sehen – also auch zu sehen, wie man selbst sich unter verschiedenen Bedingungen im Alltag verhält, verhalten könnte oder in Zukunft verhalten möchte – verlangt immer auch den Mut, sich unschönen Wahrheiten zu stellen. Die Erkenntnisse des Rezipienten, also das, was die Kunst ihm mitteilt und vermittelt, ist immer abhängig von seiner eigenen Tiefe. Desto tiefer sich ein Kunstwerk in unsere Seele einschneidet, desto tiefgreifender die Transformation, die möglicherweise stattfinden könnte.
Literatur ist hierfür besonders effizient, vielleicht einer von vielen Gründen, warum es Bibliotherapie gibt. Das liegt daran, dass Literatur von ihren Lesern mehr verlangt als ein Film von seinen Zuschauern. Literatur bittet um unsere aktive Teilnahme — Vor allem klassische Literatur verlangt Aufmerksamkeit, Konzentration und Kontemplation, um wie ein Samen der gewässert wird, Früchte tragen zu können.
Es gibt ein Wort namens „Inscendenz“ – es ist der Impuls, sich nicht über die Welt zu erheben (Transzendenz), sondern in sie hineinzusteigen, ihren Kern zu suchen – ein Begriff, der von Thomas Berry geprägt wurde. Die Literatur bietet dieses tiefere Suchen und letztendlich auch das Erreichen eines Kerns: wenn es nicht der Kern des globalen Bewusstseins ist, den man findet, dann der Kern der eigenen Psyche. Wir Menschen erreichen unsere „Höhepunkt“, unseren Kern oder unsere Essenz, wenn wir uns selbst bestmöglich ausdrücken können. Wenn es uns gelingt, uns durch ein effektives Medium darzustellen. Wir berühren auch dann unsere eigene Essenz, wenn es uns gelingt, unsere Psyche durch tiefgreifende transformative Literatur zu fühlen und ihre innersten Motive wirklich zu begreifen.
Lyudmila Ulitskaya schrieb: „Literatur ist das Beste, was die Menschheit hat. Poesie ist das Herz der Literatur, die höchste Konzentration von allem, was das Beste in der Welt und im Menschen ist. Es ist die einzig wahre Nahrung für deine Seele.“
Es gibt eine enge Verbindung zwischen Kunst und Wahnsinn, und der leidende Künstler ist eine beispielhafte Figur dieser Verbindung. Eine Figur, der man in der Dichtung oft begegnet – vertreten durch Figuren wie Rimbaud oder Hölderlin.
So notiert Susan Sontag in „Der Künstler als beispielhafter Leidender“, dass der Heilige durch den Schriftsteller als beispielhaften Leidenden ersetzt wird. Kunst und Literatur haben konfessionelle Elemente, die oft als Voraussetzung für Heilung und Transformation dienen. Ohne unsere Wunden anzuschauen und anzuerkennen, können wir sie nicht heilen.
Der Schriftsteller befindet sich in der Position eines exemplarischen Leidenden, weil von ihm erwartet wird, dass er die tiefste Ebene des Leidens erlebt hat, aber auch ein professionelles Medium besitzt, mit dem er sein Leid sublimieren kann – im wörtlichen, nicht im Freudschen Sinne.
Als Mann leidet er, aber als Schriftsteller verwandelt er sein Leiden in Kunst.
Er verwandelt Schmerz in Kraft und inspiriert den Empfänger, dasselbe zu tun.
Der Leser wiederum leidet möglicherweise auch als Mensch und kann die Existenz seines Leidens zunächst anerkennen und dann ein tieferes Verständnis dafür gewinnen. Der Vorleser fühlt sich erlaubt, sein Leid an der literarischen Figur mitzuerleben, sie personifiziert ihn und so versucht er sich im Gegenzug zu personifizieren, um seinem Leseerlebnis gerecht zu werden. Es ist ein Spiegel, den man nicht anschaut, sondern in den man tritt. Der Schriftsteller ist der Mann, der den Nutzen des Leidens in der Ökonomie der Kunst entdeckt – so wie die Heiligen die Nützlichkeit und Notwendigkeit des Leidens in der Ökonomie der Erlösung entdeckten. Der Künstler oder Schriftsteller könnte auch als jemand gesehen werden, der hungert. Mangel ist immer ein Teil des Leidens – bei Krankheit vermisst man die Gesundheit, in der Stille vermisst man die Kommunikation und so weiter. Jemand, der leidet, hungert also – aber Literatur bietet Substanz. Sie ist etwas, das man verarbeiten und verdauen muss.
Die Leere, die mit Leiden und Hungern einhergeht, wird also von Literatur ausgefüllt, ähnlich wie eine Seele mit Licht oder mit Dunkelheit gefüllt werden kann. Man nimmt Energie und schafft Substanz und Sinn anstatt in Leere und Sinnlosigkeit eines zwecklosen Leidens zu ertrinken.
Scham verwandelt jede noch so kleine Emotion in einen riesigen Fleck auf der Leinwand unserer Persönlichkeit und die kleinsten Entscheidungen in die schlimmsten Fehler: Wir sind der oder die Einzige im Freundeskreis, der oder die mit Mitte dreißig noch Single ist. Jeder wird herausfinden, dass mit uns etwas nicht stimmt. Wir werden auf die kleinsten Zornesfalten aufmerksam, die niemandem je auffallen würden, versuchen sie mit Botox zu bekämpfen und denken unser Alterungsprozess verläuft aggressiver als bei allen Bekannten. Wir haben zu viel gegessen, fühlen uns wie ein Monster und bestrafen uns damit, nun eine Woche keinen Zucker zu uns zu nehmen. Wir sehen nicht immer gut aus, also fühlen wir das als moralischen Mangel und fühlen uns nicht als guter Mensch. Scham will uns erzählen, dass wir verdammt sind, dass wir kaum etwas erreicht haben und nichts mehr erreichen werden. Sie ist das Gegenteil von Kunst, von Freude, von Lebendigkeit. Sie eine Art der manifestierten Depression, und Depressionen und Scham gehen oft Hand in Hand: Der depressive Mensch sieht sich als unzulänglich und wird durch die Depression noch mehr paralysiert. Er ist zu depressiv, etwas zu verändern, doch allein der Versuch einer Änderung führt zu intensiver Scham, denn er zeigt ja nur, was alles falsch ist und schief läuft — der Zirkel aus Scham und Depression führt in eine Abwärtsspirale.
Wenn wir von unserer Scham geleitet werden, ist alles was wir tun mangelhaft und peinlich.
Kannst du dich an das erste mal dass dich jemand nervig genannt hat erinnern? Wie dein Atem kurzatmig wurde und sich ein Gefühl der Enge auf deine Brust gelegt hat? Wie deine Augen getränt haben und deine Wangen sich angefühlt haben, als würden sie brennen. Deine Augen richtest du heute immer noch auf den Boden, wenn du einen Raum betrittst. Mittlerweile bist du Erwachsen und hältst dich zurück, wenn du zu laut oder zu lange sprichst, zu offen lachst, zu bunt gekleidet bist, zu mittig im Raum stehst, zu talentiert in irgendwas bist. Du entschuldigst dich für deine Talente wie andere es für Straftaten tun würden. Du entschuldigst dich für deine Anwesenheit als würdest du selbst deine Abwesenheit wünschen. So verlassen dich deine Talente allmählich, weil du sie nicht kultivierst.
Du denkst, dass du zu viel bist und traust dich aus diesem Grund nicht einmal genug zu sein.
So etwas führt zu Selbstsabotage.
Erst, wenn wir unsere Individualität ausleben und uns trauen, unsere Inneren Leidenschaften ins außen zu tragen, geben wir uns und Anderen die Chance, das Paradigma zu ändern, Scham in Freude zu verwandeln und Depression zu Kunst zu machen.
Kunst stellt genau das Gegenteil von Depressionen dar: Sie ist stolz darauf,
sich präsentieren zu können, sie will gesehen und bewundert werden.
Es liegt nichts würdevolles oder bewundernswertes darin, uns zu verstecken.
Sobald wir beginnen uns in irgendeiner Form verstecken zu wollen, müssen wir uns fragen: wieso? Was bezwecken wir damit? Was möchten wir vor uns selbst oder anderen geheim halten und was würde passieren, wenn wir unser Versteck durch eine Bühne ersetzen würden?
Selbst, wenn etwas objektiv betrachtet vielleicht kein Kunstwerk ist, kann es mit genügend Selbstbewusstsein und Präsenz dazu werden; nicht, weil es fehlerlos ist, sondern weil der Stolz der Kreation es dazu macht.
Was tötet eine Seele ? Erschöpfung, ein Image aufrechterhalten, Perfektionismus. Was lässt eine Seele wieder auferstehen? Gnade, Anmut, Authentizität und Verbindungen, die auf Ehrlichkeit aufbauen. Alles, sämtliche Ehen, Partnerschaften, Freundschaften, aber auch ein Berufsleben, das nicht auf dem integren Fundament der Ehrlichkeit gebaut wurde, steht auf einem Fundament, das früher oder später wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen wird.
Unser Zugehörigkeitsgefühl wird nie unsere Selbstakzeptanz überschreiten können, denn Letztere determiniert, inwiefern wir uns trauen, unser offenes, ehrliches, authentisches Selbst mit anderen zu teilen. Wenn wir bedenken, dass Babys und Kleinkinder sterben, wenn sie nicht geliebt und umsorgt werden, wenn sie keine ausreichenden Berührungen erhalten, können wir erkennen, inwiefern das Akzeptieren von uns Selbst uns zum Leben befähigt. Wir sehen auch, von welchem Ausmaß diese scheinbar selbstverständlichen Dinge sind und wieso es sich lohnt, an ihnen zu arbeiten.
Unser Ziel sollte darin liegen, uns selbst offen so zu zeigen, wie wir uns fühlen und uns selbst damit gut zu fühlen, denn auch wenn man uns verurteilt, lassen wir selbst davon ab. John Bradshaw, der Autor von ‚Heilung von der Scham die dich zurückhält‘, betont, wie Scham intensiver wird, desto mehr wir sie zurückhalten wollen. Wir können internalisierte Scham nicht ändern, bis wir sie externalisieren. Die Arbeit dazu ist zwar einfach, aber doch komplex, denn sie beinhaltet Methoden, die Bradshaw ‚Externalisation’ nennt. Darunter gehören zum Einen und Ersten, dass wir aus unserem eigenen Versteck kommen und uns in unserer Verletzlichkeit zeigen. Nur wenn man gesehen wird, gibt man sich die Chance, neu zu erkannt zu werden und sich selbst neu zu erkennen. Anschließend sollte man sich und seine Normalität von mindestens einer Person gespiegelt kriegen, die der Scham nicht zuspielt, sie nicht hervorruft, sondern darüber hinwegsieht. Die uns Normalität spiegelt, wo vorher Scham war. Die weiß, dass Scham auch zur Normalität gehört, ohne, dass ein Mensch darüber definiert wird. Bradshaw nennt dies eine ‚interpersonale Brücke’, über die die sich schämende Person gehen muss, um sich wieder aus einer normaleren Perspektive wahrnehmen zu können. Zur Reduktion von Scham gehört auch, das Trauma zu legitimieren, welches sich um das Verlassenwerden kreist: Die Angst verlassen zu werden, wenn andere herausfinden, dass man eine Person ist, der gewisse Dinge passiert sind. Eine Person also, für deren Bekanntschaft man sich schämen könnte. Über diese paralysierende Sorge muss ebenso gesprochen werden, wie über das traumatische Ereignis, um das die Scham kreist. Denn nur so kann die betreffende Person verbale Rückversicherung erhalten und eine korrigierende Erfahrungen machen.
Außerdem kann sie das eigene Trauma aufarbeiten, um zu realisieren, dass es nicht selbstverschuldet war und bloß die Scham letztendlich der Teil des Traumas ist, den man nach wie vor freiwillig mit sich herumträgt, obwohl man die Vergangenheit — und die Scham dieser — doch hinter sich lassen möchte.
Wir müssen die betreffenden, unter ihrer Scham leidenden Personen daran erinnern, dass sie liebenswert sind, und selbst wenn eine Person nicht willens oder fähig dazu ist, sich selbst zu lieben oder anzunehmen, wird man immer jemanden finden können, der durch seine heilende und nicht verurteilende Präsenz die eigene Trauer teilt und die Scham versteht, ohne das Trauma zu kritisieren.
Egal wie schwach, hässlich, klein und untalentiert jemand sich fühlt, man muss sich immer daran erinnern und erinnert werden, dass das nicht die eigene Identität widerspiegelt.
Dass ein Trauma nie die Macht hat, jemanden zu definieren. Dass es nie ausmachen wird, wer man war und sein wird, egal was noch kommen mag.
Ein Grund dafür, unseren Körper ernst zu nehmen, der von dem Hintergrund der allgegenwärtigen Diätkultur und den Mechanismen sozialen Zwangs sowieso schon eine mutige Entscheidung mit schwerwiegenden Konsequenzen ist, ist auch, dass wir dadurch, dass wir Seele und Körper zu respektieren beginnen, plötzlich auf sämtliche Prozesse und Lebensbereiche aufmerksam werden, die diesem Prozess entgegenstehen.
Desto mehr wir uns selbst respektieren und zu unserer Würde zurückfinden, desto mehr werden wir, weil wir ein Gefühl für den Begriff der Würde entwickelt haben, die Verletzungen unserer Würde in anderen Lebensbereichen bemerken, wo sie uns vorher kaum aufgefallen sind.
Wenn uns auffällt, wie erschöpft und fahrig wir durch die 40 Stunden Woche sind, werden wir merken, wie schlecht dieses System für unsere Gesundheit ist und einen Schritt gegen das System tun. Damit beleidigen wir alle, die sich mit diesem System identifizieren und wenn wir unser Arbeitszeitmodell entsprechend unseren Bedürfnissen anpassen und zu einer Teilzeitbeschäftigung übergehen, realisieren wir gleichzeitig, wie sehr es uns tatsächlich geschadet hat und wie befreiend ein Schritt der Selbstfürsorge sich anfühlen kann.
Wir erkennen nach und nach, wie die Systeme und Mechanismen dieser Gesellschaft davon profitieren, dass wir uns selbst nicht respektieren und uns selbst keine Fürsorge zukommen lassen.
Die Schönheitsindustrie würde morgen pleitegehen, wenn heute plötzlich alle Frauen die Entscheidung treffen würden, sich anzunehmen wie wir sind. Die Fitnessstudios würden morgen pleitegehen, würden wir realisieren, wie viel gesünder und erfüllender es ist, mit dem Hund Gassi zu gehen, anstatt uns wie Hamster in einem Laufrad abzuzappeln, dabei noch einen möglichst sportlichen Eindruck zu hinterlassen und für die Fahrt zum Studio sowie für die Mitgliedschaft viel Zeit und Geld aufbringen zu müssen.
Der Preis für alles ist unser Leben: Die Energie und Zeit, die wir geben.
Wenn wir Frauen lernen, unser natürliches Haar zu belassen und unseren Körper wertzuschätzen und auf chemische Stoffe und gesundheitsschädliche Eingriffe wie künstliche Aufhellung, chemisches Glätten, toxisches Botox oder Hyaluron zu verzichten, wird uns auch bewusster, in welchen anderen Bereichen unsere natürliche Natur kastriert und unser weiblicher Ausdruck sexualisiert oder übertrieben maskulinisiert wurde. Von der Geschlechts- und Genderdarstellung, über Misogynie und Fremdenhass bis hin zum Umweltrassismus, werden selbst subtilste Eingriffe in die menschliche Würde offensichtlicher. Unser Blick muss allerdings erst auf diese Themen gerichtet werden, um sie zu sehen.
Und das tun wir am besten, indem wir uns persönlich angesprochen fühlen oder involvieren.
Oft können wir erst erahnen, wie es sich für andere anfühlen muss, wenn es uns selbst irgendwo betroffen hat. Wenn es andere angeht, können wir uns nur in deren Erleben hereinfühlen — und trotzdem hilft das bereits eine Sensibilisierung für die Entscheidung zu schaffen, sich selbst mehr zu respektieren, egal wie verschieden die Konsequenzen im spezifischen für den Einzelnen aussehen mögen.
Viele von uns, die heute noch Zeuge sind können morgen vielleicht schon Opfer sein. Wir lesen über das Kündigen sinnloser ‚Bullshit Jobs‘, oder darüber dass immer mehr Menschen Therapieangebote wahrnehmen, oder auf natürliche Kosmetika zu setzen beginnen und dann beginnen wir plötzlich selbst gemütlichere Kleidung zu tragen, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, Achtsamkeit zu erlernen, vegan zu leben, auf naturbelassene Nahrung zu vertrauen, die Umwelt durch elektronische Autos zu schonen und beim Investment auf Ökologie zu achten oder ähnliches.
Es gibt so viele Wege, auf unseren Körper einzugehen: zu spüren, wann wir müde sind oder zu merken, wann unser Gewicht seinen gesunden Setpoint verlässt.
Doch diese Gabe, die sich „Interozeption“ nennt, und u.a bei essgestörten Menschen nicht mehr auf natürliche Weise greifen kann, wird uns immer mehr entzogen und durch ein Überwachungssystem aus Messgeräten, Laufuhren, BMI, Blutdruckmesser, Wagen, PH Tests usw. Ersetzt, welches dazu führt, dass wir das natürliche Gefühl für uns selbst —unsere Interozeptionsfähigkeit— immer mehr verlieren. Denn obwohl es immer mehr Messgeräte, Diäten und Kuren gibt, steigt der Anteil der Bevölkerung mit erheblichen Übergewicht und anderen Essstörungen immer mehr an. Würden diese Kontroll- und Überwachungssysteme hilfreich sein, müsste sich ja eigentlich längst die gegenteilige Entwicklung zeigen.
Je mehr Mitgefühl wir für unseren eigenen Körper und unsere Seele entwickeln, desto schneller wird ein Kratzer zu einer Wunde und eine Wunde zu einer Chance der Heilung.
Desto mehr Selbstfürsorge wir betreiben, desto empfindlicher reagieren wir auf Misshandlungen, die von Außen an uns herangetragen und als normal preisgegeben werden und desto schneller entwickeln wir als Antwort auf diesen Affront unserer Würde auch Möglichkeiten, diese wieder zu regenerieren. Die verborgenen Systeme und Mechanismen, die uns lehren, uns selbst zu hassen, werden sichtbarer. Wir können sie analysieren, verstehen und transformieren. Wir können andere auf sie aufmerksam machen. Nicht in predigender Tonalität, sondern in Rücksicht gegenüber der existierenden Konformität. Diese Systeme werden derart verinnerlicht, dass sie von vielen Menschen noch bekräftigt werden — unter anderem sämtliche Beauty Influencer, die der Welt das bestehende Ideal zum Preis ihrer physischen und psychischen Gesundheit verkaufen. Diese Mechanismen werden vom Außen ins Innere getragen und vom Inneren wieder in die Welt gegeben. Deswegen braucht es oft Zeit, um zu merken, wie überholt sie sind: Die Wahrheit zeigt sich oft erst, wenn die Zeit die Lüge aushöhlt wie eine Flut die Felsen.
Die Aufrechterhaltung falscher Mechanismen und Systeme und die irreversiblen Schäden, die sie uns zufügen, kann auf Dauer nicht schöngeredet oder durch Werbung, Trends, Influencer oder gefeierte Erfolgsgeschichten kaschiert werden.
Man wird erkennen, dass manche im Kollektiv zelebrierten Ideale nichts als leere Fassaden sind. Wenn wir aber gesündere Werte nach außen tragen und unsere Heilung wird zu einer stillen Demonstration gegen alle Systeme, die sie uns entziehen würden wird, dann kann sie auch zu einer stillen Revolution für alle, die sie gerne erlernen und übernehmen würden, werden.
Wenn wir uns in unserer Familie früher als „schwarzes Schaf“ gefühlt haben oder familiär so behandelt wurden, dann weil wir die Dinge anders gefühlt und gesehen oder anders gehandelt haben als andere Mitglieder unserer Familie oder einer sonstigen Gemeinschaft, die uns geprägt hat. Vielleicht haben wir auch anders ausgesehen oder geklungen.
Vielleicht widersprachen unsere Lebensentscheidungen dem, was normal oder erlaubt war.
Wenn wir uns als ‚schwarzes Schaf‘ gefühlt haben, entweder subtil, ohne, dass etwas direkt laut gesagt wurde oder deutlicher, indem wir von unseren Herkunftsfamilien oder sonstigen Gemeinschaften abgelehnt wurden, sollten wir wissen, dass es häufig die mental gesündeste Person einer Familie oder einer Gemeinschaft ist, die als anders, schwierig oder kompliziert bezeichnet oder gar ausgegrenzt wird.
Das liegt daran, dass das „schwarze Schaf“ in dysfunktionalen Familien oft zum tragenden Bestandteil des kollektiven, unbewussten psychologischen Projektionsprozesses dieser Familie wird.
Das heißt im Wesentlichen, dass die Gefühle des Schmerzes, der Spannung und der Angst, die die Familienmitglieder oder Angehörigen der betreffenden Gemeinschaft in diesem dysfunktionalen System empfinden, auf diese Person (das ‚schwarze Schaf‘) geschoben und ausgelagert werden, die dann psychisch und manchmal auch physisch die toxische und emotional aufgeladene Energie der Familie oder Gemeinschaft „auffangen muss“, was sich oft in gewissen Symptomen und Verhaltensweisen manifestiert, auf die die anderen Mitglieder der Gruppe dann wiederum hinweisen und sagen können: „Da ist das Problem — sie ist es, nicht wir!“
Auf diese Weise können wir als Sündenbock unbewusst als „Schutzfunktion“ für die größeren dysfunktionalen Muster fungieren.
Denn wenn mit den Fingern auf uns gezeigt wird, weil wir uns weigern, uns den bestehenden Dysfunktionen zu unterwerfen, dann soll somit gleichzeitig erreicht werden, dass wir eingeschüchtert werden und nicht länger an der Wahrheit festhalten; sodass wir also aufhören, die bestehenden Dysfunktionen für Andere (Außenstehende) sichtbar zu machen.
In toxischen Familien oder Systemen gilt das scheinbar perfekte Bild, das der Außenwelt präsentiert wird, als heilig — wird es kritisiert oder angezweifelt, dann muss die betreffende Person mit Ausgrenzung rechnen.
Deswegen werden die negativen Gefühle, die auf uns projiziert werden, häufig heftiger und stärker, desto mehr wir zu uns selbst und zu unserer Wahrheit stehen und desto mehr auch Außenstehende, also nicht im System gefangene Personen, uns darin unterstützen.
Das Problem sind also nicht wir als das ‚schwarze Schaf’ oder als ausgegrenzte Person, sondern vielmehr diejenige Familie oder Gemeinschaft, die uns auszuschließen versucht.
Denn wenn wir hinter die Muster und Abläufe einer Gemeinschaft oder einer Familie blicken und die Schwachpunkte klar erkennen können, stellen wir eine Gefahr für dieses System dar.
Doch weil die Familie der Ort ist, in den wir hineingeboren werden, beginnen wir eher selten, die dort erlernten Verhaltensweisen- und Muster zu hinterfragen oder zu analysieren— auch nicht die dysfunktionalen.
Das heißt, dass wir uns oft unbewusst in die Abläufe, Traditionen oder Routinen einfügen, mit denen wir groß werden, bis wir vielleicht etwas lesen oder eine einschneidende Erfahrung machen, die uns wachrüttelt. Dann werden wir uns über gesunde oder ungesunde Verhaltensweisen und Rollenverteilungen immer bewusster und weigern uns, noch weiter an gewissen Dingen teilzunehmen. Wenn wir dann beginnen, die anderen Mitglieder der Familie oder der Gruppe zu kritisieren oder Grenzen zu setzen, wo vorher keine waren, dann ist Widerstand und im schlimmsten Fall Ausgrenzung zu erwarten.
Trotzdem kann gerade jemand, der als kompliziert bezeichnet wird oder als schwarzes Schaf behandelt wird, derjenige werden, der den Kreislauf dysfunktionaler Verhaltensmuster und Familienrollen- oder Traditionen nachhaltig durchbricht.
Wenn ich ein Loch in ein Stück Papier schneiden würde, wäre das Loch an sich Beweis einer Präsenz durch eine Abwesenheit. Mangel setzt Existenz voraus.
Sehnsucht wirkt auf ähnliche Weise — würde man die Kartographie der Sehnsucht nachzeichnen, würde man sehen, wie sie sich immer wieder vom liebenden zum Objekt der Sehnsucht bewegt und dann wider zurück, so Anne Carson. Immer wieder. Darum geht es auch in den meisten Liebesliedern, Gedichten oder Romanen — es geht weniger darum, dass man etwas ersehnt und dann erhalten hat als um die eigene Leere, die die Sehnsucht von vornherein möglich gemacht hat. Es geht um das Loch in uns, von dem wir hoffen, dass es durch das Liebesobjekt oder den ersehnten Lebenswandel gefüllt werden kann. Wir lieben und leben oft genauso — selbstsüchtig und wie Verhungernde, die sich an die erstbesten Sehnsüchte klammern.
Die Begierde im Hegelianischen Sinne geht sogar davon aus, dass wir — dadurch dass wir so hungrig sind, so voller Begehren — dem anderen Objekt seine eigene Bedeutung entziehen. Wenn wir beispielsweise Hunger haben und vor uns eine Birne liegen würde, wird die Birne von uns nur in Bezug auf ihre Nährstoffe und die Befriedigung die wir durch sie kriegen können definiert. Wir würden sie nicht als einen Samen sehen, der gekeimt ist und einen Lebenszyklus fortsetzt. Genauso beschäftigen wir uns auch nicht mit der selbstdefinierenden Andersartigkeit des Anderen (Objektes/Menschen). Sehnsucht ist daher oftmals nicht nur das Gefühl etwas zu wollen, sondern es ist das gierige Konsumieren von etwas oder jemandem um unser eigenes Selbstwertgefühl zu nähren. Wir lieben und begehen andere Dinge rücksichtslos. Gleichzeitig ist Sehnsucht fast immer mit einem gewissen Schmerz verbunden — unter anderem weil wir unsere Sehnsucht immer nur auf etwas richten können das nicht ganz da ist. Unsere Sehnsüchte sind immer widersprüchlich: wir möchten, dass jemand uns liebt, wenn er uns aber voll und ganz ergeben wäre, würden wir aufhören ihn zu lieben. Wir ersehnen immer nur das, was nie ganz da sein kann. Die Griechen wussten das und haben dieses Phänomen „Eros“ genannt.
Dass wir sehnsuchtsvolle Wesen sind, wird heutzutage gesellschaftlich jedoch auch immer öfter gegen uns gerichtet: Verlangen wird mimetisch instrumentalisiert — also nachahmend. Wir wollen das, was andere haben und wir wollen das Gewollt werden an sich. Begierde ist immer Begierde des Anderen, schrieb der französische Philosoph Kojève. Wenn wir gewollt werden, so denken wir, wird das unsere gesellschaftliche Position sichern oder uns zu Erfolg oder finanziellem Reichtum verhelfen. Diese Sehnsucht wird überall eingesetzt, sodass sie uns fast ohnmächtig werden lässt — auf Dating Apps, in degradierenden TV Shows oder in anderweitigen Leistungs- und Konkurrenzkämpfen, die von unserer Gesellschaft hochgehalten werden. An einem Ort wird uns möglicherweise Anerkennung vorenthalten, anderenorts wird eine Sehnsucht generiert, die völlig künstlich ist und uns somit immer mehr von uns selbst entfernt. All die gestressten, unzufriedenen, erfolgreichen und ehrgeizigen Menschen, die wir jeden Tag in der Stadt sehen können, haben sich verirrt— und sie rennen jeden Tag weiter vor sich selbst weg. Im Spiel der Sehnsucht sind die Medien, die Politiker und die Unternehmen die Hauptakteure, die uns zu Nebenfiguren machen wollen. Traurig nur, dass das auf dem Spielfeld unseres Lebens geschieht und der Preis dafür unsere Seele ist.
Jesus als historische Figur brach diesen Zirkel der selbstsüchtigen Sehnsucht, indem er am Kreuz starb. Er tauschte Selbstlosigkeit gegen Selbstsucht aus. Er widerstand sämtlichen weltlichen Einflüssen, indem er sich dem höchsten Einfluss vollständig im letzten Tabu hingab.
Biblische Kunst erinnert uns immer wieder an die Wunde, das Loch (die Sehnsucht) in uns, das wir immer spüren und mit Weltlichen Dingen zu füllen versuchen. Das werden wir aber nie schaffen können, da es existiert, weil wir von Gott getrennt wurden und uns immer an diese Trennung erinnern sollen.
Die Seitenwunde von Jesus selbst, Caravaggio’s gemalte „Ungläubigkeit des Heiligen Thomas“, die ikonographische Darstellung des gefallenen Mannes. Leid, die Darstellung und Anerkennung von Schmerz, ist Bestandteil unserer Gesellschaft. Immer wieder wurde der menschliche Körper im Schmerz gezeigt, wie er ums Überleben kämpfte, um Mitleid, Mitgefühl oder Unterstützung bat. Tatsächlich ging es in diesen Bildern und der Ikonographie darum, die Menschheit hinter diesen gefallenen Körpern anzuerkennen, also einem leidenden menschlichen Körper, der nicht vergessen werden oder umsonst sterben darf. Leid ist somit das, was uns zum Subjekt werden lässt.
Die amerikanische Soziologin Margaret Mead wurde gefragt, was das erste Zeichen von Zivilisation sei und sie antwortete darauf, dass es ein gebrochener Oberschenkelknochen war, der geheilt wurde. Dieser sei Beweis dafür gewesen, dass jemand bei dem Gestürzten geblieben war, die Wunde verbunden hatte und ihm während der Genesung beigestanden sei. Jemandem in Schwierigkeiten zu helfen, weil sein Leid anerkannt wurde und er als Subjekt gesehen wurde, war der Beginn unserer Zivilisation.
Wie alle haben also eine Leere in uns, so etwas wie ein Vakuum, das wir immer zu füllen versuchen. Wonach wir streben, womit wir den Schmerz dieser Leere/Wunde zu füllen hoffen, ist ausschlaggebend dafür wer wir sind. Wir denken oft, wir werden von Liebe angetrieben, dabei ist es oft dieser Schmerz der Leere, den wir loswerden oder vermeiden wollen. Wir lieben nicht wirklich selbstlos wie Simone Weil schrieb, den Hunger der Anderen. Wir lieben öfter so, dass wir uns durch den anderen nähren wollen, dass wir jemanden quasi „konsumieren“ wollen. Die Medien und die großen Konzerne wissen das alles und versuchen uns Sehnsüchte zu verkaufen, um sie dann zu füllen. Es werden immer mehr und immer künstlichere Sehnsüchte produziert, die eine völlig entfremdete und unerfüllte Gesellschaft hervorbringen.
Wenn es um Liebe geht, dann werden wir seit frühester Kindheit darauf konditioniert, dass sie im Idealfall mit großen Gesten der Zuneigung, roten Rosen oder aufwendigem Heiratsanträgen einhergeht. Reality TV und Disney Filme tun ihr Übriges.
Vor allem für Menschen, die in narzisstisch geprägten Familiensystemen aufwachsen, in denen der äußere Schein über das innere Wohlbefinden gestellt wird, mag es eine Herausforderung sein, nicht in die gedankliche Falle zu tappen, zu denken, dass äußere Bekundungen, finanzielle Unterstützung oder Statussymbole Ausdruck wahrer Liebe sind.
Wahre Liebe jedoch zeigt sich nur durch emotionale Intimität, denn nur durch sie ist ein tiefes Gefühl der Verbundenheit möglich.
Natürlich schließt das Eine das Andere nicht per se aus, aber Voraussetzung für wahre Liebe ist immer das Gefühl, bei der anderen Person sicher zu sein.
Unsere Vorstellung von Romantik sollte also nicht nur „Honeymoon“ oder ein gutes Intimleben beinhalten, sondern vor allem Ruhe, Geborgenheit und Gesten der Fürsorge. Wenn unsere Bedürfnisse anerkannt und gesehen werden, wenn unser Gegenüber emotional reif genug ist, auf unsere wie seine Emotionen gesund zu reagieren anstatt reaktiv oder defensiv zu werden und wenn wir gemeinsam in eine Richtung schauen, für dieselben Werte stehen und dieselben Vorstellungen teilen, dann stellt sich das Gefühl von Sicherheit ein und der erste Schritt zu emotionaler Intimität ist getan.
Intimität ist ein Wort, dessen Wurzeln aus dem lateinischen ‚intimum‘ kommen, was so viel wie Innerlichkeit oder innerer Kern bedeutet. Wenn jemand im Innern nur Leere oder Wunden besitzt, dann ist wahre Intimität nicht möglich.
Deswegen sind auch Reife und Selbstliebe tragende Bedingungen für wahre Intimität: Jemand muss sich selbst als Person für wertvoll halten, sein Inneres erkundet haben, seine eigenen Leidenschaften und Sehnsüchte kennen und seine eigene Erfüllung zuerst ohne eine andere Person finden. Denn nur dann wird die andere Person nicht als Substitut oder Ablenkung für die eigene innere Leere benutzt. Und nur dann ist wahre Verbindung anstatt Abhängigkeit oder Anhaften möglich.
Nur, wenn man sich selbst erfüllen kann, kann man die innere Fülle mit der anderen Person teilen und es kommen zwei reife Menschen zusammen, die einander geben können anstatt zwei leere Seelen, die aus ihrer inneren Wunde oder ihrem inneren Kind heraus handeln und
voneinander nehmen, bis sie sich leer und ausgelaugt fühlen.
Denn als Kinder sind wir abhängig —
wir können weder emotional noch finanziell auf eigenen Beinen stehen.
Und wenn unser Inneres verletztes Kind aktiv in eine Beziehung eintritt, dann basiert die Liebe auf einem Gefühl der Bedürftigkeit anstatt auf einem Gefühl der Fülle oder des Überschwangs.
Und dann passiert es oft, dass wir Verbundenheit mit emotionaler Abhängigkeit oder Besitz verwechseln.
Dabei hat Verbundenheit mit Besitztum oder Anhaften nichts zu tun. Und Geschenke sind in Beziehungen dieser Art häufig nichts anderes, als der Versuch einer emotional unreifen Person, die Liebe oder Zuneigung einer anderen Person zu ‚kaufen‘.
Es ist tatsächlich so, dass Beziehungen, in denen viele Geschenke gemacht werden oft nur wenig emotionale Intimität besitzen und Materialismus als Mittel dienen soll, diese herzustellen oder ihren Mangel auszugleichen.
Aber weil Verbundenheit letztlich über den Erfolg oder Misserfolg einer Beziehung entscheidet, können Geschenke diesen Zweck gar nicht erfüllen.
Die Spiegelung gewisser Gegensätze hat mich immer fasziniert. Selbst in mir selbst: Wie kann ich manchmal so voller Sensibilität und Sanftheit und manchmal so voller Rücksichtslosigkeit und Brutalität sein? Gut und Böse sind vielleicht nicht die zwei Gegensätze, für die wir sie halten — vielmehr scheint es, als seien sie zwei Seiten einer Medaille. Eine Seite befindet sich metaphorisch gesehen im warmen Haus und wird am Kamin gewärmt und fühlt sich geliebt oder geborgen, während die andere Seite draußen in der Kälte vor einem gefrierenden Fenster steht und verzweifelt hereinzukommen versucht. Daran versuche ich mich zu erinnern, wenn ich jemanden als bösartig oder verbittert bezeichnen möchte. Und wenn ich mich selbst als Opfer von Hass oder Neid sehe, erinnere ich mich daran, dass die Worte für ‚Liebhaber‘ und ‚Feind‘ im hebräischen identisch sind {…} oder, dass im armenischen die Wörter ‚Monster’ und ‚Engel‘ aus derselben Wurzel stammen.
Die Vorstellung, dass alle Gegensätze lediglich unterschiedliche Aspekte desselben Phänomens sind ist eines der Grundprinzipien der östlichen Lebensweise. Da alle Gegensätze voneinander abhängig sind, kann ihr Konflikt niemals zum vollständigen Sieg einer Seite führen.
So schrieb Simone Weil beispielsweise: ‚ich weiß nicht, ob ich an Wut als etwas glaube, dass immer im Gegensatz zur Zärtlichkeit steht. Ich glaube eher daran, dass beides miteinander verflochten ist. Zwei Elemente des Versuchs in einer Welt zu überleben wenn man erst einmal die Gewaltfähigkeit dieser Welt verstanden hat.‘ Und Henry Miller schrieb, dass Brutalität oft nur die andere Seite der Sentimentalität sei. Tatsächlich ist es so, dass ich mich oft erschrocken habe, wenn ich gesehen habe, zu welcher Gewalt selbst die — oder gerade die — sanftmütigsten Menschen fähig sind. Wut ist ein schwieriges Thema, insbesondere für uns Frauen, die wir für unsere Wut kollektiv verurteilt werden. Viele von uns wissen nicht, wie wir unsere Wut zulassen oder verarbeiten können, weil uns nie erlaubt war, wütend zu sein. Aber Wut ist wichtig.
Unsere Wut ist der Teil von uns, der weiß, dass wir ungerecht behandelt wurden und entsprechend darauf reagiert. Wut ist in Liebe getaucht. Wenn wir auf unsere Wut hören, sie aber mehr auf die Lösung von Problemen als auf die Fehler anderer Menschen richten, kann sie ein mächtiger Antrieb sein. Die destruktive Macht unserer Emotionen muss nur in Veränderung münden anstatt in unserem Geist zu stagnieren und zu Gift zu werden.
Generell sollten wir dennoch versuchen, uns in unserer Wut selbst zu reflektieren — ist sie noch konstruktiv? Motiviert sie uns zu Veränderungen oder richten wir sie gegen uns? Viele von uns sind schnell und oft wegen Kleinigkeiten verärgert, während Dinge, die uns wirklich ärgern sollten, wie zB wie viel Zeit wir täglich im Verkehr verbringen, uns kaum auffallen. Aristoteles schrieb in diesem Zusammenhang: ‚Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber auf die richtige Person wütend zu sein, im richtigen Ausmaß, zur richtigen Zeit, aus dem richtigen Grund und auf die richtige Art und Weise, das liegt nicht in jedermanns Macht und ist nicht einfach.‘
Vereinfacht kann man zwischen drei Haushalten unterscheiden, in denen wir aufwachsen. Den Low-intensity Haushalt, in dem wir als Kinder die Fürsorge und Aufmerksamkeit erhalten, die wir brauchen und in dem klare Regeln und feste Strukturen den Alltag bestimmen; den Medium-intensity Haushalt, in dem es häufiger zu Reibereien oder Auseinandersetzungen und nicht selten zu Trennungen kommt, wo häufig Spannung in der Luft liegt, deren Ursache man aber nie wirklich greifen kann, sodass immer wieder eine eher gereizte Atmosphäre entsteht und letztlich den High- Intensity Haushalt, in dem es kaum Regeln oder Vorgaben gibt, die Kinder und Eltern untereinander Krieg führen oder eine durch Umzüge, Trennungen oder Drogen/Alkoholkonsum bedingte generelle Instabilität herrscht.
Die wenigsten von uns wachsen in Ersteren Haushalten auf, und wenn, dann ist dies ein enormes Geschenk.
Aber für den Rest von uns heißt das, dass wir bereits mit gewissen Wunden und Vorbelastungen ins Erwachsenenalter starten mussten.
Die meisten Menschen haben nicht das Glück, in ruhigen Haushalten aufzuwachsen, sondern viele von uns wachsen in sehr konfliktbehafteten Verhältnissen auf.
Konflikte, Chaos, mangelnde Struktur und Traumata waren für viele von uns die Regel. Und wenn man diese Muster aus der Kindheit kennt, dann wiederholt man sie immer wieder unbewusst, ganz einfach, weil sie sich natürlich anfühlen.
Oscar Wilde sagte: „Ein verbranntes Kind liebt das Feuer.“ Ein anderes Zitat lautet: „Wenn du mit einen wutverzerrtem Mann in deinem Haus groß geworden bist, dann wird immer ein wutverzerrter Mann in deinem Haus sein.“ Unverarbeitetes Trauma ruft impulsive und unvorhersehbare Verhaltensweisen hervor, lässt Menschen irrational handeln und aus einer dysfunktionalen Emotionsregulation immer wieder dieselben Kreisläufe wiederholen. Das Tückische daran ist, dass der Körper sich an die damit einhergehenden Stresshormone gewöhnt
und sich sogar defekt fühlt, wenn der Stress dann irgendwann nicht mehr da ist.
Denn Stress kann süchtig machen, auch wenn er unzählige negative Aspekte mit sich bringt.
Es ist ein Trick, den unser Gehirn uns vorspielt: Zusätzlich zu Cortisol setzt Stress Dopamin frei, eine „Wohlfühl“-Chemikalie, die zu wiederholten Verhaltensweisen anregt, indem sie das Belohnungszentrum unseres Gehirns aktiviert. Deswegen sagt man ‚verletzte Menschen verletzen Menschen‘.
So können ironischerweise gerade die besonnenen und ruhigeren Typen unter uns auf der Arbeit für die Adrenalin Junkies geradezu wie Trigger wirken.
Ich habe oft mitkriegen müssen, wie über ruhige Menschen dann geredet wird:
• nimmt sie das hier etwa nicht ernst?
• sie denkt wohl, dass sie sich nicht beweisen muss.
• sie ist mir irgendwie unheimlich, wer weiß was die sich denkt.
• sie tut nur so lieb, eigentlich ist sie ganz anders als sie sich gibt.
• wenn ich sie wäre, würde ich das nicht so entspannt angehen.
• sie denkt wohl, sie steht über allem.
• ganz schön hochnäsig, sich immer aus allem rauszuhalten.
• sie ist überhaupt kein Teamplayer, wie sie nie wirklich für eine Seite eintritt.
Aber aus welchen Mustern andere Menschen ihre Beziehungen kreieren und welche Wunden sie mit sich tragen, wird nie in unserer Kontrolle liegen.
Wir müssen uns, gerade auf dem Arbeitsplatz, um gute Abgrenzung und mentale Hygiene kümmern und können nur hoffen, dass generell mehr Bewusstsein für authentischere Dialoge entsteht und wir alle beginnen, uns selbst und die Menschen in unserer Umgebung auf gesunde —nicht verurteilende— Weise tiefergehend zu reflektieren.
Dann werden wir auch sehen, dass hinter dem ständigen Drang nach Chaos nur das geringe Selbstwertgefühl eines verwundeten Kindes steckt, das sich nach Aufmerksamkeit und Liebe sehnt. Menschen mit hohem Selbstwertgefühl kreieren kein Chaos, um dann mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Sie schätzen sich selbst zu hoch, um andere derart gering zu schätzen.
Nach Carl Rogers sind es drei Aspekte, die gelingende Kommunikation in therapeutischen Settings ausmachen, sich aber auch auf Zwischenmenschliche Kommunikation im allgemeinen beziehen lassen. Zum einen braucht es Echtheit, Authentizität: Desto mehr der Therapeut keine professionelle Fassade einnimmt, sondern er selbst ist, desto offener entwickelt sich das Gespräch.
Auf diese Weise ist es nicht konstruiert, es wird nicht zu einem Leitfaden der abgearbeitet wird, sondern es öffnet sich wie ein Buch, das man aufschlagen kann, um es gemeinsam zu lesen.
Der Klient soll nicht das Gefühl haben, dass der Therapeut ihm etwas vorenthält, sondern das Gespräch soll transparent bleiben.
Die zweite Charakteristik ist Akzeptanz und das was Rogers ‚bedingungslose positive Anteilnahme‘ nennt — desto mehr der Therapeut den Klienten im positivem Sinne annimmt und das, was der Patient darstellt und ausdrückt ihm widerspiegelt, desto mehr fühlt dieser sich dazu ermutigt, sich mehr zu öffnen und es entsteht ein natürlicher Flow, eine Ungezwungenheit.
Der dritte Aspekt ist ‚Empathisches Verständnis’. Das bedeutet der Therapeut erkennt die Gefühle und Gedanken, die der Klient explizit ausdrückt, genauso wie die, die unter der Oberfläche dessen liegen was gesagt wird. Er kommuniziert daraufhin sein Verständnis und seine Empathie.
Diese Art des sensiblen und aktiven Zuhörens ist selten anzufinden. Rogers nennt diese Art des Zuhörens eine der potentesten Formen der Kommunikation, um Veränderung zu bewirken.
Desto mehr der Klient Wertschätzung und Anerkennung erfährt, desto mehr empfindet er sich ihr würdig, im besten Falle verinnerlicht er diesen respektvollen Umgang und überträgt ihn auf sich selbst. Dann beginnt er selbst achtsamer und aufmerksamer auf seine inneren Erfahrungen zu hören, ebenso wie auf die darunter liegenden Nachrichten. Desto mehr eine Person ihr Selbst anerkennt und wertschätzt, desto mehr wird sie also auf ihren inneren Monolog achten und die Erfahrungen die während einer Therapie gemacht werden, werden kongruenter. Ansätze, Vorschläge oder Ratschläge können so leichter integriert und umgesetzt werden. Auch die kognitive Umstrukturierung der negativen Glaubenssätze in positivere kann erst fruchtbar werden, wenn der Patient auf die Stimmen in seinem Inneren achtsam eingeht und sie sensibel in einer konstruktivere Richtung lenkt, anstatt sie achtlos zu unterdrücken oder grob zu dementieren. Der Patient erfährt eine größere Freiheit, eine lautere Erlaubnis, eine bejahende Stimme, die ihn dazu inspiriert, öfter und in immer größerem Ausmaß er selbst zu sein.
Manche Patienten erleben die Therapie als ersten Ort und als erstes Mal in ihrem Leben, an dem sie sie selbst sein dürfen, ohne dafür verurteilt zu werden.
Ohne sich selbst masochistisch klein machen oder sich größenwahnsinnig selbst erheben zu müssen, um gesehen oder erhört zu werden. Sie müssen ihrer Seele keine Handschellen oder Fesseln umlegen. Sie dürfen Mensch sein und in ihrer Menschlichkeit wahr- und angenommen werden.
Rogers vergleicht die Versuche psychisch erkrankter Menschen, sich selbst zu organisieren, mit Kartoffeln, die er im Winter in dem Keller seines Elternhauses gefunden hat. Die Kartoffeln lagerten in einem dunklen Raum mit einem kleinen Fenster, mehrere Meter unter dem Erdgeschoss. Aus ihnen wuchsen 2-3 Meter lange weiße Sprossen hervor, die in Richtung des Fensters wuchsen.
Rogers sieht darin eine Tendenz, die im ganzen Universum beobachtbar ist und auf natürliche Weise ihr Potential, das Potential eines sich selbst organisierenden Prozesses, realisieren möchte. Alles organisch Lebende, von den kleinsten Atomen bis hin zu den größten Lebewesen, strebe danach, das im Innern inhärente Potenzial so zu organisieren, dass es sich bestmöglich realisieren und vermehren könne.
Alles Lebendige strebe danach sich selbst komplexer zu machen, weiter auszubauen und zu mehr zu machen als es vorher war. Und in diesen im Keller gelagerten Kartoffeln sah Rogers das Beispiel für einen misslungenen Versuch dieses Prozesses nach Wachstum.
Sie würden nie normal wachsen, den Winter überleben, essbar sein, denn sie wurden falsch gelagert und konnten den Winter nicht überleben.
So sei es Rogers zufolge auch mit Menschen, die in ungünstigen Bedingungen oder mit mangelnden Ressourcen aufwachsen, Missbrauch erleben oder auf andere Art und Weise fehlgeleitet werden. Sie würden zwar versuchen zu wachsen und ihr Potenzial zu nutzen, doch sie würden es auf falschem Wege tun, weil sie den richtigen Weg nicht kennen würden: Jugendliche beispielsweise, die von ihren Lehrern nie anerkannt und von ihren Eltern nie unterstützt wurden, würden eher dazu neigen ihre schulische Laufbahn aufgeben, weil sie merken, dass sie auf kriminellem Wege schnellere Ergebnisse ihrer Arbeit sehen würden oder dass ihr Einsatz ever wahrgenommen würde und in Resonanz mit gewissen inneren Energien wie der Frustration, die sich über die Jahre aufgebaut hat, gehen würde.
Das Potential dieser Jugendlichen ginge dann nicht verloren, es würde einfach falsch frei- bzw. eingesetzt.
Und doch könnten sie selbst auf diesem Wege gewisse Tugenden wie Ehrgeiz, Ausdauer oder Durchhaltevermögen entwickeln, denn die universelle Tendenz zu höherer Struktur und zur Realisierung des eigenen Potentials ist von Natur aus eine Tendenz, die konstruktiv ist.
Das ist das, was für Rogers so bedeutend ist: Es ist nicht natürlich, dass Menschen sich selbst zerstören. Es ist die Ausnahme. Die natürliche und universelle Tendenz unserer Seele besteht darin, nach immer höherer Struktur und Organisation zu streben. So weiß die menschliche Seele selbst an den dunkelsten Orten, wie auf der Straße oder in kriminellen Geschäften, noch Tugenden wie eben Ausdauer, Brüderlichkeit oder Durchhaltevermögen zu schätzen. Sie findet immer irgendwo ein Fenster, durch das Licht ins Dunkel scheinen kann.
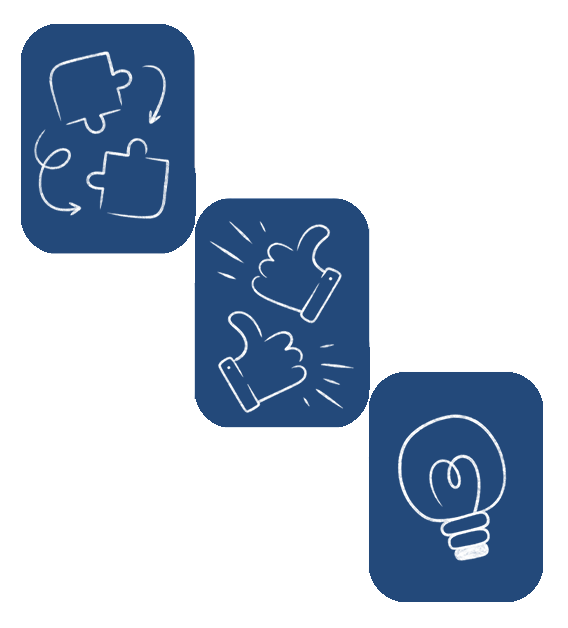
Warten Sie nicht länger, den ersten Schritt in Richtung Wohlbefinden zu gehen. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungen für Ihre Herausforderungen und gestalten Ihren persönlichen Weg zur mentalen Gesundheit.
Diese Internetseite kann Ihnen helfen, eine erste Orientierung bei der Suche nach Unterstützung zu gewinnen. Mein Schwerpunkt liegt in der
Verhaltenstherapie bei Erwachsenen.
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung
© Copyright Laura Thiessies 2024.
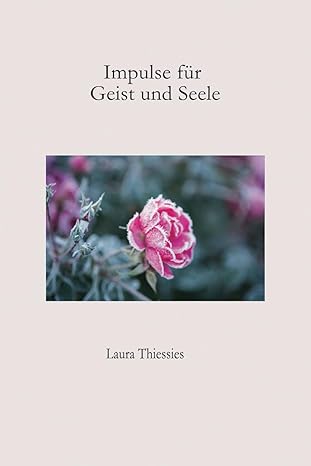
Die perfekte Anordnung von Worten kann eine seit Jahren bestehende Wunde im Herzen innerhalb von Sekunden durch eine neue Erkenntnis heilen. Die Kraft der Literatur ist real.
In dieser Kollektion aus Textausschnitten, Zitaten und Gedichten werden tiefgreifende Themen wie Liebe und Hass, mentale Gesundheit, Religion, Trauer, Friede und Sehnsucht mit Zeilen thematisiert, die sich wie Samen in unseren Geist legen können – mit dem Potential, ihn zum Blühen zu bringen. Diskret und elegant, einfach und anmutig in ihrer Sensibilität, befreien sie uns zumindest stückweise von dem Staub der alltäglichen negativen Gedankenspiralen, die uns alle ab und an belasten.